
Roger Rekless, aka David Mayonga. Foto: Philipp Wulk
Roger Rekless: „Menschen haben sich selbst eine Plattform geschaffen“
Immer häufiger engagieren sich Menschen online, um auf Diskriminierungen aufmerksam zu machen und gemeinsam für mehr Gerechtigkeit einzustehen. Einer von ihnen ist der Rapper Roger Rekless. Ein Gespräch über digitalen Aktivismus.
Der Künstler David Mayonga, aka Roger Rekless, verhandelt die Themen Rassismus und Diskriminierung schon eine ganze Weile: als Rapper in seinen Songs, als Autor in seinem Buch, als Content Creator auf TikTok in seinen Kurzvideos. Fast 5.000 Menschen folgen ihm auf der Video-Plattform, die thematisch ganz vielfältig aufgestellt ist.
So ist es auch bei Roger: Mal rappt er, dann macht er mit Inklusionsaktivist Raul Krauthausen den #Privilegiencheck: Eine TikTok-Challenge, bei der man sich als Person ohne Behinderung seiner Privilegien bewusst werden kann. Ein anderes Video auf seinem Profil zeigt Roger vor 25.000 Menschen, während er auf der Black-Lives-Matter-Demo in München über seine Erfahrungen mit Rassismus und das Aufwachsen als Schwarzer Mensch im ländlichen Bayern spricht.
Für viele seiner Videos auf TikTok nutzt Roger das Hashtag #BLMistkeinTrend. Damit will er darauf aufmerksam machen, wie wichtig eine nachhaltige Auseinandersetzung mit Rassismus und den Zielen der BIPoC-Community, also den Menschen, die sich selbst als Black/Indigenous/People of Color bezeichnen, ist: Denn antirassistische Arbeit ist kein Hype, sondern bleibt so lange eine Notwendigkeit, bis wir als weiße Mehrheitsgesellschaft rassistische Strukturen überwunden haben. Wir haben mit ihm über digitalen Aktivismus gesprochen, was er sich von seiner Community wünscht und wie er optimistisch bleibt.
Lange Zeit war Aktivismus mit bestimmten Aktionen verknüpft: Demonstrationen zum Beispiel. Inzwischen nutzen aber auch viele Menschen ihre Online-Reichweite, um auf vielfältige Formen von Diskriminierungen hinzuweisen. Wie kann dieser digitale Aktivismus aussehen?
Erfahrungen teilen, gemeinsam lernen
Auf der Black-Lives-Matter-Demonstration in München spricht Roger Rekless über seine Erfahrungen mit Rassismus. Seine Rede teilt er auf seinem TikTok-Profil.Roger Rekless: Jeder Aktivismus ist wichtig. Digitaler Aktivismus sollte auch nicht von den aktivistischen Tätigkeiten offline entkoppelt sein, sondern sie sichtbar machen. Aktivist*innen können digitale Medien, soziale Netzwerke und Video-Plattformen wie TikTok dazu nutzen, um auf Missstände hinzuweisen und diese durch ihre Reichweiten einer breiteren Zuhörer*innenschaft zugänglich machen.
Hast du dafür ein Beispiel?
Roger Rekless: Zum Beispiel können Expert*innenmeinungen und Beiträge von direkt betroffenen Menschen hörbar und erlebbar gemacht werden. Talks wie „Sitzplatzreservierung“ von Hadnet Tesfai und Aminata Belli werden eben auch durch die digitale Welt ermöglicht. Wo zuvor wenig Repräsentanz in den Medien stattfand, haben sich diese Menschen einfach selbst eine Plattform geschaffen. Und genau das ist meines Erachtens ein wichtiger Teil von digitalem Aktivismus: Sichtbarkeit, Empowerment und Selbstbestimmung.
Du bist in Markt Schwaben, einem Ort in der Nähe von München, aufgewachsen und hast dort schon früh als Schwarze Person Rassismus erlebt. Wenn du als betroffene Person Bildungsarbeit leistest, oft kostenlos, musst du auch immer deine eigenen Erfahrungen teilen und sicher auch wieder durchleben. Ist das nicht sehr anstrengend?
Roger Rekless: Ja, es ist sehr anstrengend. Neben netten Worten wie „Danke für deine Arbeit!“ bekomme ich selten etwas zurück. Deshalb ist es auch wichtig, dass Allies, also weiße Menschen, die uns als Verbündete unterstützen wollen, aktivistische Aufgaben übernehmen können.
Warum machst du es trotzdem?
Roger Rekless: Ich schöpfe Energie aus der Community – damit meine ich alle Menschen, die von Rassismus und Antisemitismus betroffen sind. Durch die Digitalisierung sind wir noch weitaus enger zusammengerückt. Gerade Menschen, die mehrfache Diskriminierungserfahrungen gleichzeitig machen, die zum Beispiel rassistisch und aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Identifikation diskriminiert werden, werden endlich immer mehr als das wahrgenommen, was sie sind: Vorreiter*innen und Kämpfer*innen. Gleichzeitig wird ebenso klar, dass deren Arbeit und deren Kämpfe jahrelang auch innerhalb der BIPoC-Community nicht gesehen wurden. Ich schöpfe daraus viel Energie, wenn ich merke, wie Teile der BIPoC-Community sich weiterbilden und damit genau das tun, was wir auch von der weißen Mehrheitsgesellschaft, oder zumindest von unseren Allies, erwarten.
Du hast eben von Allies gesprochen – also von Menschen, die anderen von Diskriminierung betroffenen Menschen helfen und sie unterstützen wollen. Wie sieht Solidarität online und offline für dich aus? Wie könnte dich die Gesellschaft, oder kleiner gedacht, die TikTok-Community, unterstützen?
Roger Rekless: Es hilft schon, wenn sie Inhalte von BIPoC-Expert*innen teilen, ihnen Raum geben oder sich auf der Plattform mit den eigenen internalisierten Diskriminierungsmustern auseinandersetzen. Das betrifft nicht nur weiße Menschen. Wir alle müssen uns mit der rassistischen Lehre und dem rassistischen Gedankengut, das leider tief in unserer Gesellschaft verankert ist, auseinandersetzen, um es besser erkennen zu können. Mein Tipp: Hört vor allem dann zu, wenn ihr euch von einer Aussage ertappt fühlt und ihr dadurch eure Komfortzone verlassen müsst. Außerhalb des Angelernten, außerhalb der Komfortzone, fängt die Veränderung an.
Viele Menschen haben ja genau in so einem Moment Angst, das vermeintlich Falsche zu sagen. Manche scheuen dann eine Auseinandersetzung mit den eigenen Rassismen, halten sich als Konsequenz generell vom Diskus fern oder verteidigen sich. Was rätst du diesen Menschen?
Roger Rekless: Für mich ist das eine Ausrede. Wenn ich ein Instrument lernen möchte und aus Angst davor, falsche Noten zu spielen, gar nicht spiele, dann komme ich auch nicht weit, oder? Wenn ich dann von meiner*m Klavierlehrer*in auf eine falsche Note aufmerksam gemacht werde, dann sage ich doch auch nicht: „Das war gar keine falsche Note! Sie verstehen nur nicht, was ich hier spielen will! Früher, als ich noch gar keine Noten kannte, durfte ich auch auf allen Tasten herumdrücken und niemanden hat es gestört!“ Ich finde, das ist wirklich ein gutes Beispiel. Wer lernen will, der muss sich trauen, Fehler zu machen. Und die Person muss diese unangenehmen Situationen verdammt nochmal aushalten können, ohne ständig in ein Verteidigungsmuster zu verfallen. Das kann auch eine Art von Verbundenheit sein: das Unangenehme aushalten, um wachsen und lernen zu können. Irgendwann spielt man dann die korrekten Noten. Nicht, weil man andere Noten nicht spielen darf, sondern weil man weiß, welche Noten man für das gelungene Musikstück braucht.
Gibt es einen Grund für Optimismus und Zuversicht?
Roger Rekless: Der Grund für Optimismus ist die Alternativlosigkeit. Wir müssen optimistisch sein, sonst können wir gleich aufgeben. Alle, die schon Jahrzehnte vor uns für die gleichen Dinge gekämpft haben, würden wir durch unser Aufgeben sabotieren. Das heißt nicht, dass ich nicht oft genau das verspüre: Hoffnungslosigkeit.
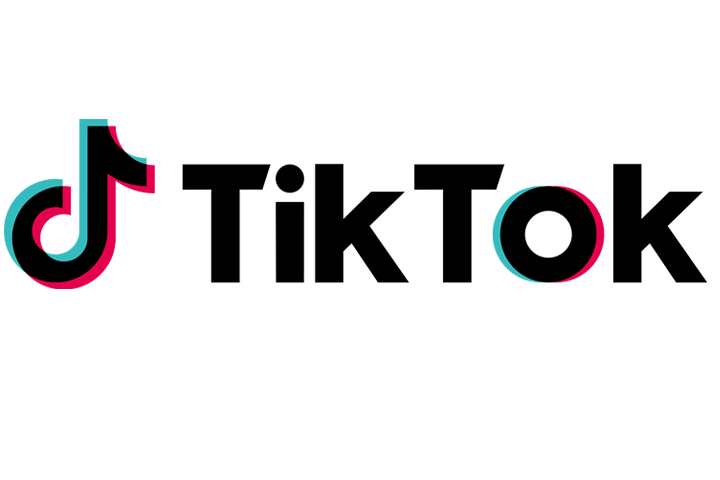
TikTok ist mehr als du denkst
Große Erkenntnisse, große gesellschaftliche Bewegungen oder großer Spaß liegen manchmal nur einen Swipe auseinander. In 60 Sekunden kann man auf TikTok so gut wie alles lernen und sich über fast alles mit einer lebendigen Community austauschen. Mehr Infos hier.
Oder das Gefühl, dass sich in der weißen Mehrheitsgesellschaft nichts geändert hat. Aber dann sehe ich unsere Vernetzung innerhalb der Communities, ich sehe vermehrt Menschen, die mich eher repräsentieren und Schwarze Menschen, die in Entscheider*innen-Positionen sind. Und dann denke ich mir: Genau das haben alle vor uns erarbeitet. Wir müssen da weitermachen – auch wenn es nur Babysteps sind, die von der weißen Mehrheitsgesellschaft mitgegangen werden. Wir sind die Veränderung. Und das kann uns niemand nehmen.
Deine drei Tipps für einen respektvollen Dialog?
1. Lernen ist ein lebenslanger Prozess. Das ist wichtig zu begreifen.
2. Veränderung ist positiv, die Arbeit daran auch. Unterschiedliche Lebensrealitäten zu kennen und zu respektieren und die Bedürfnisse der Menschen zu verstehen sind Fähigkeiten, die wir brauchen. Leider werden diese Fähigkeiten noch oft unterschätzt.
3. Halte es aus, wenn eine deiner Handlungen von einer betroffenen Person als rassistisch oder diskriminierend empfunden wird. Die Deutungshoheit darüber, was jemand als verletzend empfindet, liegt bei der Person. Nicht bei dir.
Danke für das Gespräch.